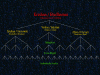Die Bhagavad-Gita (Lied, Gedicht, „der Gesang des Erhabenen“), gilt als Essenz des Hinduismus.
"Der vermutlich zwischen dem
5. und dem
2. Jahrhundert v. Chr. entstandene
Text ist eine Zusammenführung mehrerer verschiedener Denkschulen des damaligen
Indien auf Grundlage der älteren
Veden (Frühvedische Schriften ca. 1200 v. Chr. bis 900 v. Chr.), der
Upanishaden (Spätvedische Schriften ca. 700 v. Chr. bis 500 v. Chr.), des orthodoxen
Brahmanismus (ca. 800 v. Chr. bis 500 v. Chr.), des
Yoga u. a. m., steht aber den Upanishaden gedanklich am nächsten."
Mit der Gita wird das alte System des Brahmanismus revolutioniert, indem als oberster Gott nun Krishna gilt. Vorher war es Indra, der bei den Römern Jupiter, den Griechen Zeus, den Germanen Thor und bei den Juden Jahwe hiess. Gleichzeitig entsprang Buddha dem Brahmanismus und ging fortan eigene Wege.
"Die Bhagavad Gita muss als Teil des
Mahābhārata, „die große Geschichte der Bharatas“, der Schrift über die Familie Bharata und deren Nachkommen (
Schlacht zu Kurukshetra) gesehen werden; und ein Teil der Mahabharata war eben die Bhagavad Gita. Der Seher Saṃjaya schilderte in dem Gesamtepos dem blinden König
Dhritarashtra den Kampf der beiden Bhāratafamilien den („guten“)
Pāṇḍavas und den („bösen“)
Kauravas um die Macht.
In der Bhagavad Gita bildet sich
Zwiegespräch zwischen
Krishna einer irdischen Erscheinungsform von
Vishnu, dem Lehrer, und
Arjuna, dem Schüler ab.
Da fragt sich, wer ist denn nun die Erscheinungsform von wem? Sie sind eigentlich beide der Gleiche, so kann man es vielleicht vereinfacht erklären.
"Vishnu avanciert, in der Zeit der Niederschrift des Werkes, neben
Shiva zu einem der Hauptgötter des Hinduismus. Krishna, der
Protagonist der Bhagavad Gita, gilt als
Avatara, als
Inkarnation des Gottes Vishnu auf Erden. In der
Rahmenhandlung der Mahābhārata bzw. Bhagavad Gita legte Krishna, als Manifestation des Göttlichen, dem jungen Krieger und Prinzen Arjuna auf dem Schlachtfeld die Grundgedanken über das Leben dar, hierbei zeigte er ihm sein göttliches Wesen und unterweist ihn in Verhaltensregeln zum Erkennen des Göttlichen.
Hindus betrachten die Lehren der Bhagavad-Gita traditionell als Quintessenz der Veden. Beim Studium ergeben sich oft scheinbare Widersprüche: Während einige Stellen anscheinend einen Dualismus lehren – die Zweiheit von Natur und Geist, von Gott und Mensch –, lehren andere die Einheit. "
Sri Chaitanya hat diesen scheinbaren Wiederspruch mit dem "unbegreiflichen gleichzeitigem Eins- und Getrenntsein von Gott" erklärt (Achintya Bhedabheda).
"Entsprechend der
hinduistischen Mythologie leben wir jetzt im
Kali-Yuga, dem „dunklen, schwarzen Zeitalter“, das nach Krishnas Tod begann (3102 v. Chr.). Von Krishna heißt es, er sei gekommen, um den Menschen jene
ethischen und
philosophischen Unterweisungen zu geben, die für die Zeit dieses
Yuga notwendig seien. In Kapitel IV, 7–8 verspricht Krishna, immer wieder zu inkarnieren:
„O Sohn des Bharata, so oft ein Niedergang des Dharma (Rechtschaffenheit, Tugend) und ein Überhandnehmen von Ungerechtigkeit und Laster in der Welt eintritt, erschaffe ich mich selbst unter den Kreaturen. So verkörpere ich mich von Zeitalter zu Zeitalter für die Bewahrung der Gerechten, die Zerstörung der Boshaften und die Aufrichtung des Dharma.“
Krishna kommt in der Bhagavad-Gita, je nach Kontext, unterschiedliche Bedeutung zu: Einmal wird er als das kosmische Selbst angesehen, das alles Lebende durchdringt; ein anderer Aspekt ist die Bedeutung als innere Göttlichkeit, die eine Reflexion des kosmischen Selbstes in jedem Lebewesen ist. Eine dritte Funktion ist die des spirituellen Lehrers."
Nach Sri Chaitanya hat Krishna drei Aspekte:
1. Die Bhagavan-Form als Gestalt des Krishna.
2. Die Überseele (Paramatma), die im Herzen eines Jeden ist.
3. Das alldurchdringene Brahman, das von der Bhagavan-Form ausgeht und aus dem alles gemacht ist.
"Die Bhagavada Gita fußt auf den Grundlagen der älteren Veden, so den
Frühvedische Schriften, dem orthodoxen
Brahmanismus, Schriften des
Yogas aber insbesondere den Upanishaden, als
Spätvedische Schriften, letztere beschäftigten sich mit der Essenz der vier Veden und bildeten so die Grundlage des
Vedanta. Ursprünglich entwickelten sich zu den einzelnen Veden entsprechende Schulen, sodass verschiedene Vedaschulen existierten. Aus einer dieser Schulen bzw. Lehrmeinungen stammten die Upanishaden. In ihnen werden die Begriffe
Brahman und
Atman weiter ausgeformt. Alles Existierende ist gegenüber dem Absoluten eine Täuschung, eine Illusion (
Maya). Maya des verblendeten Egos, das die Realität als nur psychisch und mental versteht und das wahre
Selbst, das Atman, das eins mit Brahman ist, nicht erkennt. Um
Moksha (Erlösung) zu erreichen, muss der Zustand der Maya überwunden werden."
"Krishna unterscheidet zwischen Wirklichem und Nichtwirklichem. Das Wirkliche ist Atman, das Sein selbst, das Gewahrsein, reines Bewusstsein, das unerkennbar, unmanifestiert und unzerstörbar ist. Das Nichtwirkliche ist die gewöhnlich wahrgenommene Welt. Als Identifikation mit dem Körper, die durch das Ego hervorgerufen wird entsteht die Täuschung (Maya), dass die Welt wirklich ist. In allen Wesen, in allem Seienden ist Atman enthalten und damit ist alles göttlich. Atman ist in allem, aber es ist kein Teil von ihm. Die Schwierigkeit besteht in der Unterscheidung zwischen der Welt, dem Nichtwirklichen und dem Göttlichen, dem Wirklichen. Durch die Weisheit der Unterscheidung von Wirklichem und Nichtwirklichem erlangt man Glückseligkeit."
"Viele Hindus sehen diese Schlacht als
Allegorie. Eine mögliche und weit verbreitete Sichtweise ist, dass es sich um ein Zwiegespräch handelt zwischen der inneren Göttlichkeit, verkörpert durch Krishna, und der menschlichen Seele, die Arjuna darstellt: das Schlachtfeld sei das Leben, und die feindlichen Heerscharen, gegen die Arjuna antreten muss, verkörperten die menschlichen Schwächen, die besiegt und überwunden werden müssten. Neben dieser sich auf das Individuum beziehenden Deutung ist es möglich, der Bhagavad-Gita eine Deutung zu geben, die sich auf die Menschheit als Ganzes bezieht. In dieser
evolutionären Anschauung ist die Schlacht ein Aufeinandertreffen der
asurischen,
egoistischen Kräfte mit denen der göttlichen Ordnung. Arjuna und seine Mitstreiter werden in diesem Bemühen von
Krishna, dem
Avatar, angeführt und unterstützt.
Das Bild der Kutsche mit Krishna als Wagenlenker und dem verzweifelten Arjuna ist ein bekanntes und weit verbreitetes Motiv darstellender Kunst und als Wandschmuck in vielen Hindu-Haushalten zu finden. Eine populäre Deutung dieses geistigen Bildes enthält die Katha-Upanishade (II.3–4):
„Erkenne den Atman als den Herrn der Kutsche. Der Körper ist der Wagen, die Buddhi (Vernunft) der Wagenlenker und das Denken die Zügel. Die Sinne sind die Pferde, die Objekte die Wege.“"
(
Wikipedia)