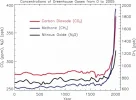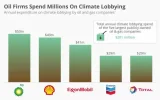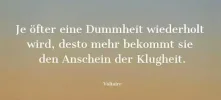Teil 2
Viele von Marshalls Analysen und Reflexionen sind erhellend und hilfreich. Ein "intelligentes und geniales Buch" hat die
Washington Post in ihrer Rezension
Don't Even Think About It genannt. Natürlich bietet Marshall nicht zu allen Problemen, die er aufzeigt, auch Lösungen und konkrete Ratschläge an – aber zu etlichen:
• Zuallererst, rät Marshall, sollten Klimakommunikatoren an ihrer
SPRACHE arbeiten. Sollten zum Beispiel über das reden, was man sicher weiß – statt wissenschaftliche Unsicherheiten zu betonen. Sie sollten die Folgen des Klimawandels im Hier und Jetzt ansprechen und zeigen – statt künftige Generationen oder die Eisbären in der Arktis (weil dies die emotionale Distanz zum Klimawandel nur erhöht). Sie sollten Katastrophenschilderungen eher vermeiden, zumindest immer Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten mitliefern, um Abstumpfung und Lähmung zu vermeiden. Allerdings dürfe man auch nicht in eine Haltung verfallen, die Marshall
bright-siding nennt, also schönfärberisch und überoptimistisch technologische Lösungen für die Klimakrise ausmalen – weil das den Eindruck bestärkt, man könne man in den Industrieländern weitermachen wie bisher.
• Weil über die Akzeptanz einer Botschaft weniger ihr Inhalt entscheidet als ihr Überbringer, sollten Klimakommunikatoren
NEUE BOTSCHAFTER suchen. Man kann eine breite Öffentlichkeit und auch skeptische Zuhörer besser erreichen, wenn beispielsweise Feuerwehrleute über Waldbrände erzählen oder Militärs über sicherheitspolitischen
Aspekte des Klimawandels. Oder wenn sich, wie im vergangenen Jahr, der Papst zu Wort meldet. Und statt zum x-ten Male Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse referieren zu lassen, sollten man sie auch mal über sich selbst reden lassen – über ihre Motivation, ihre Gefühle, was sie ängstigt.
• Klimaforschern rät Marshall übrigens explizit,
NICHT IN TALKSHOWS mit Wissenschaftsleugnern zu debattieren. In diese m Gesprächsformat und der dort vorgegebenen Rededauer könnten sie nur verlieren.
• Klimakommunikation darf nicht nur Fakten liefern, sondern muss auch
GESCHICHTEN erzählen. Denn von Kindheit an erschließen sich Menschen die Welt durch Geschichten. Sind Informationen in Geschichten eingebettet, merkt man sie sich leichter und akzeptiert sie eher. Mehr noch: Eine wahre, aber dröge Story hat es sehr schwer gegen eine, die zwar erlogen ist, aber spannend. Welcher der beiden folgenden Sätze bleibt eher hängen? "Nach Abwägung aller Erkenntnisse kommen viele Wissenschaftler zu dem Schluss, dass unsere Emissionen höchstwahrscheinlich das Klima schädigen"? Oder: "Gemeine Wissenschaftler haben sich verschworen und fälschen Forschungsergebnisse, um mehr Fördergelder zu bekommen"?
• INDIVIDUELLE APPELLE MEIDEN, denn sie gehen oft nach hinten los. Spricht man einzelne Personen mit Verhaltenstipps an, bringt das wenig an Emissionsminderungen, löst aber oft Schuldgefühle und Abwehrreflexe aus. Nicht zuletzt zeigen psychologische Experimente, dass sich Menschen schon nach einer "guten Tat" zufrieden zurücklehnen oder gar berechtigt fühlen, an anderer Stelle unmoralisch zu handeln (Fachbegriffe:
single-action bias und
moral licensing). In einer Untersuchung bekannte zum Beispiel ein Proband, dass er sich als Vielflieger gar nicht so schlecht fühle, weil er ja zuhause jedes Stück Papier recyclet.
• Ganz am Schluss fragt das Buch, was Klimakommunikatoren
VON KIRCHEN LERNEN können. Eine Menge, meint Marshall. Üblicherweise wird ja am Klimaschutz kritisiert, er komme zu sehr daher wie eine Religion – George Marshall aber argumentiert in den Kapiteln 39 und 40 das Gegenteil. Er findet, man solle sich bei Kirchen zum Beispiel abschauen, wie sie Menschen zu einer Gemeinschaft zusammenbringen oder wie sie Schuld in konstruktive Gefühle umwandeln. Oder auch, wie sie
RAUM FÜRS TRAUERN bieten – genau solchen nämlich müssten Klimaschützer auch geben für den emotionalen Abschied vom fossilen Zeitalter, das ja liebgewonnene Vorzüge hatte. "Die klimaschonennde Welt wird neue Freuden bereithalten", so Marshall, "aber halt nicht mehr das süße Röhren eines Ford Mustang V8."
Trotz all der kommunikativen und psychologischen Schwierigkeiten, die
Don't Even Think About It ausbreitet, sieht Marshall keinen Grund zur Verzweiflung. Natürlich ist der Klimawandel ein kompliziertes Problem, natürlich sind viele harte, psychologische Nüsse zu knacken – aber unmöglich ist das nicht. (Wenn manche Wissenschaftler oder Aktivisten resigniert das Gegenteil behaupten, dann ist auch das laut Marshall nur eine Entlastungsreaktion der Psyche). Und eigentlich gebe es auch Gründe für Optimismus.
Selbst wenn es zynisch klingen mag, so sei es doch gut, dass etliche Hauptverursacherstaaten des Klimawandels auch von seinen Folgen getroffen werden – das erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass sie aktiv werden. Und: "Es ist eine sehr glückliche Fügung, dass der Klimawandel gerade jetzt auftritt – während der am längsten andauernden Friedensphase in der entwickelten Welt seit der Entstehung des Nationalstaats. Und zu einem Zeitpunkt, an der wir ein zuvor nie erreichtes Niveau an technologischen Möglichkeiten, Reichtum, Bildung und internationaler Zusammenarbeit haben." Perfektes Timing sei das zwar nicht, gibt Marshall zu – aber das beste, das man sich vorstellen kann.
Quelle
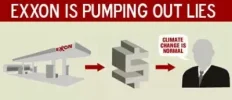



 Vernunft
Vernunft