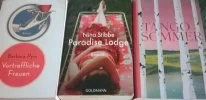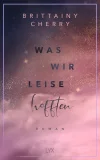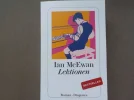Jerusalem also. Eine Stadt aus Stein, aus Blut, aus Gott. Oder besser: aus dem, was man unter ihm versteht, wenn man ihn nicht mehr versteht. Drei Religionen, ein Boden, keine Luft mehr zum Atmen. Jeder will sein Recht, aber niemand will den anderen. Wer zuerst litt, beansprucht das größere Leid. Wer zuletzt schoss, war vorher provoziert. Alles ist Erinnerung, alles ist Besitz, alles ist längst verloren – nur das Kämpfen nicht.
Die Briten, diese krönenden Verwalter des Niedergangs, wollten Ordnung halten, wie man einen Sack voller Schlangen ruhigstellt: mit leeren Versprechungen und Waffen, die sie irgendwann vergaßen einzusammeln. Die Juden, aus Asche auferstanden, schaffen sich ihren Staat, aus Notwehr, aus Überlebenskunst, aus Verzweiflung – aber bauen ihn auf einem Boden, der schon bewohnt war. Die Araber, in Zorn geboren, im Stolz erzogen, sind zerrissen zwischen Tribalismus und Großreden, zu viele Führer, zu wenig Plan – doch ihr Schmerz ist nicht weniger echt, nur ungenauer formuliert.
Und die Stadt? Die brennt, die hungert, die betet. Jerusalem ist kein Ort, sondern eine Idee, an der alle sterben wollen, solange der Tod den anderen trifft. Man will Gerechtigkeit, ja. Aber nur in der eigenen Sprache, mit dem eigenen Heiligen, mit den eigenen Toten als Beweis.
Die Weisheit von O Jerusalem? Vielleicht diese: Es gibt keinen objektiven Frieden, nur subjektive Siege. Und jeder Frieden, der auf Schuldvergessen basiert, ist bloß ein Waffenstillstand mit falschem Datum. Denn solange alle nur heilig sein wollen, wird niemand menschlich sein.




 www.3sat.de
www.3sat.de